Energiepolitik betrifft jeden. Schon immer erreichen die technischen und ökonomischen Auswirkungen der Energiepolitik alle Bürger. Aber erst mir dem Widerstand gegen die Atomkraftwerke, der Anfang der 70ziger Jahre begann, rückte ins öffentliche Bewusstsein, dass es bei der Energiepolitik um mehr geht als um die wirtschaftliche günstige Bereitstellung von Energie. Mit dem Ausbau der Kernenergie begann nicht nur die Diskussion um die ökologischen Folgen der Energie-Erzeugung, sondern auch eine Grundsatzdebatte darüber, was der Staat der Gesellschaft, uns den Bürgerinnen und Bürgern, an Bevormundung und Überwachung zumuten darf. Welche Auswirkungen die Energiepolitik haben kann, merkten wir, als der Saure Regen und seine Folgen bekannt wurden. Dass die Energiepolitik das Klima beeinflusst, war der nächste Lernerfolg. Nun, mit der fortschreitender Dauer der Energiewende ist es (fast) Allgemeingut: Energiepolitik ist Gesellschaftspolitik.
Die Vielfalt der Rollen, in denen wir als Bürger mit der Energiewende konfrontiert werden, hat dieser Woche die Helmholtz-Allianz ENERGY-TRANS dargestellt. Wir können selbst darüber entscheiden, ob wir in den Widerstand gegen die Trassenplanung gehen, Einspruch gegen den Kraftwerksneubau einlegen, ob wir unsere Energie selbst erzeugen oder es vielleicht in einer Genossenschaft tun wollen, welchen Stromanbieter wir nehmen usw. „Die Energiewende ist nicht nur eine technische Herausforderung, sondern auch ein gesellschaftlicher Prozess, den Politik und Wissenschaft gemeinsam mit den Bürgerinnen und Bürgern gestalten müssen“. (Professor Holger Hanselka, Präsident des KIT und Vizepräsident der Helmholtz-Gemeinschaft für den Forschungsbereich Energie).
Ein zentrales Forschungsergebnis der Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler bei ENERGY-TRANS war die Erkenntnis, dass Partizipation eine notwendige Voraussetzung zur Gestaltung der Energiewende ist. Energiewende bedeutet mehr „…als der Ersatz von alter durch neue Technologie. Sie ist eine gesellschaftliche Transformation.“ (Professor Armin Grunwald, Leiter des Instituts für Technikfolgenabschätzung und Systemanalyse des KIT).
Offenbar gibt es aber immer noch Akteure auf dem Energiemarkt, die die Relevanz dieser nicht ganz neuen Erkenntnis nicht begriffen haben. Dass drei große EVUs derzeit vor dem Verfassungsgericht gegen den Atomausstieg klagen, sollte in einem Rechtsstaat ein ganz normales Verfahren sein. Es geht schließlich um viel Geld. Bemerkenswert ist, wie das Verfahren geführt wird. Wenn der Anwalt eines Konzerns, der in Deutschland neben den Atomkraftwerken auch Braunkohlekraftwerke und Tagebaue betreibt, im Atomausstieg von 2011 die Menschenrechte verletzt sieht, hat das ein Geschmäckle. Wenn ein Unternehmenschef die ausbleibenden Dividenden der Rentner ins Feld führt, um eine Milliarden schwere Klage gegen den Steuerzahler zu begründen, liegt der Vorwurf der Dreistigkeit nahe.
Als die vier deutschen Atomkonzerne 2002 mit der damaligen Bundesregierung den Ausstieg verhandelten und einen entsprechenden Vertrag unterschrieben, gab es so etwas wie einen  Konsens, denn der Vertrag regelte nicht nur das Auslaufen, sondern garantierte auch den Weiterbetrieb über die sog. „Reststrommengen“. „Die Bundesregierung gewährleistet den ungestörten Betrieb der Kernkraftwerke wie auch deren Entsorgung.“ Dieser Atomkonsens wurde in der Folgezeit aber vehement von den Vertretern der Energiewirtschaft torpediert. Über ihre Lobby-Organisation, das Deutsche Atomforum, ließen sie nichts unversucht, den von ihnen unterschriebenen Vertrag wieder zurück zu drehen. Allein im Vorfeld der Bundestagswahlen 2009 setzt der Verein mehrere Millionen Euro für eine Werbekampagne ein.
Konsens, denn der Vertrag regelte nicht nur das Auslaufen, sondern garantierte auch den Weiterbetrieb über die sog. „Reststrommengen“. „Die Bundesregierung gewährleistet den ungestörten Betrieb der Kernkraftwerke wie auch deren Entsorgung.“ Dieser Atomkonsens wurde in der Folgezeit aber vehement von den Vertretern der Energiewirtschaft torpediert. Über ihre Lobby-Organisation, das Deutsche Atomforum, ließen sie nichts unversucht, den von ihnen unterschriebenen Vertrag wieder zurück zu drehen. Allein im Vorfeld der Bundestagswahlen 2009 setzt der Verein mehrere Millionen Euro für eine Werbekampagne ein.
Wie wir wissen, hatten die EVUs ihr Geld auf das richtige Pferd gesetzt. CDU, CSU und FDP bekamen eine Mehrheit im Bundestag, wurden mit einer erneuten Anzeigenkampagne unr Druck gesetzt und beschlossen im Dezember 2010 mit ihrer Mehrheit den Ausstieg vom Ausstieg. Wie die Geschichte dann weiter ging, ist bekannt.
Mit ihrem Verhalten in den nuller Jahren hatten sich die Atomkonzerne ins gesellschaftliche Abseits geschossen. Es war 2010 offenkundig: Die Konzerne hatten die Zeichen der Zeit  verschlafen, sich in ihrer alten Macht gesonnt und sich unfähig zum gesellschaftlichen Dialog gezeigt. Und sie pflegten in Teilen weiter eine Arroganz, die in der Wirtschaft nur bei Monopolisten wachsen konnte. Unvergessen wie ein EVU-Chef die Kanzlerin vor einer „Ökodiktatur“ warnte.
verschlafen, sich in ihrer alten Macht gesonnt und sich unfähig zum gesellschaftlichen Dialog gezeigt. Und sie pflegten in Teilen weiter eine Arroganz, die in der Wirtschaft nur bei Monopolisten wachsen konnte. Unvergessen wie ein EVU-Chef die Kanzlerin vor einer „Ökodiktatur“ warnte.
Während das Ringen um die Fortgestaltung der Energiewende in der realen Welt entlang der Fragen der Bürgerbeteiligung, den Wettbewerb, die Obergrenzen und den atmenden Deckel abläuft, kämpfen drei EVUs in Karlsruhe noch einmal den Kampf von gestern und zeigen dabei: Sie haben es nicht immer noch nicht begriffen. Sie klagen in Karlsruhe gegen uns alle – gegen die Steuerzahler. Ihre Klage richtet sich gegen ihre derzeitigen und gegen ihre potentiellen Kunden. Wer möchte mit seinen Klägern ins Geschäft kommen oder im Geschäft bleiben? Wer glaubt den drei EVUs ihre Rolle als unschuldige Opferlämmer, die von der Politik zur Schlachtbank geführt wurden? Die Unternehmer führten diese Woche vor großem Publikum ein Stück auf: Energiepolitik von gestern, gespielt vor dem höchsten deutschen Gericht.

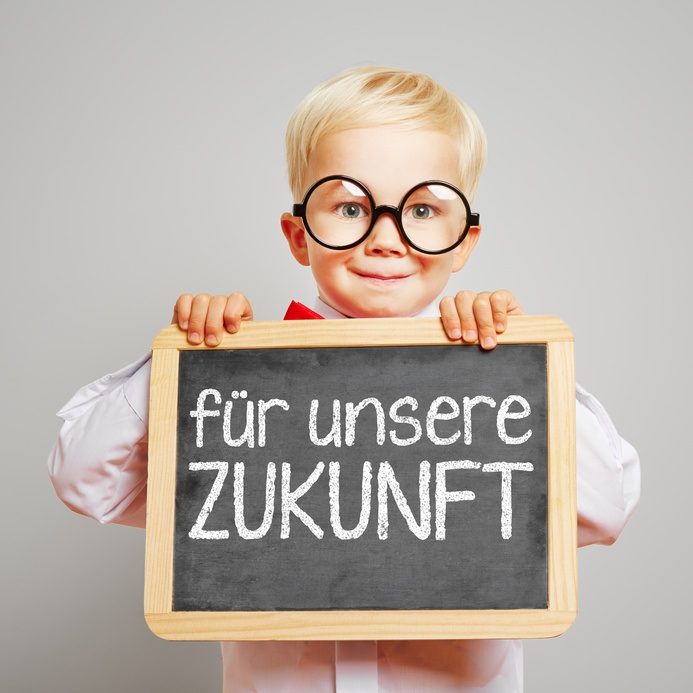
Windmüller
vor 8 JahrenDie Klage in Karlsruhe hat in der Tat ein Geschmäckle. Die KKW sind alle unterversichert, wie der Gau in Japan zeigt. Fukushima hat bis jetzt einen Schaden von umgerechnet 97 Mrd € verursacht, und das ist gerade mal der Anfang. Wo steht eigentlich geschrieben, dass die Risiken von der Allgemeinheit zu tragen sind, während die Gewinne zu privatisieren sind ? Zudem hatten die Stromkonzerne gegenüber rotgrün den Ausstieg unterschrieben. Von der Laufzeitverlängerung im Jahr 2010 bis zu den Ereignissen von Fukushima waren es 6 Monate. Da kann mir kein Stromversorger vorrechnen, dass das nun einen Schaden in Milliardenhöhe verursacht hat.